LVDI SAECVLARES - die Jahrhundertfeiern auf Münzen des Augustus und des Domitian
- Horst Herzog

- 16. Juli 2025
- 6 Min. Lesezeit
Die „ludi saeculares“ (die Jahrhundertspiele - die Säkularfeier) gehörten mit zu den vornehmsten Feierlichkeiten im kaiserzeitlichen Rom. Bereits zur Zeit der römischen Republik lassen sie sich nachweisen, so z. B. im Jahr 146 v. Chr. Betrachtet man den Zyklus von einhundert Jahren, wären die nächsten „ludi saeculares“ in den vierziger Jahren des ersten vorchristlichen Jahrhunderts fällig gewesen. Allerdings waren in dieser Zeit die politischen Verhältnisse in Rom so unsicher, dass an eine Durchführung der Feierlichkeiten nicht zu denken war. Es war dann Augustus, der im Jahr 17 v. Chr. die Säkularspiele in Aufsehen erregender Weise abhalten ließ. Die Vorbereitung und die Abhaltung der Feierlichkeiten, die vom 1. bis 3. Juni 17 v. Chr. stattfanden, ist uns durch Inschriften, die sogenannten „Acta Augustea“, gut überliefert. Für die Planung der Festlichkeit war ein eigens dafür geschaffenes Priesterkollegium, die „XV S F“ (quindecemviri Sacris Faciundis - fünfzehn Männer zur Durchführung von Opfern), zuständig, deren Vorsitz selbstverständlich Augustus innehatte. Den ungewöhnlichen Zeitpunkt der „ludi saeculares“ im Jahre 17 v. Chr., der nicht in das hundertjährige Schema passte, führte man auf Weissagungen der Sibyllinischen Bücher zurück, einer „uralten“ Sammlung von Orakelsprüchen. Diese Prophezeihungen deutete man insoweit, dass der Abstand zwischen den Spielen nicht einhundert, sondern einhundertzehn Jahre betrage. Beim Fest selbst wechselten sich Opfer an die verschiedensten Gottheiten und Spiele ab. Den Abschluss bildete das von Horaz gedichtete sogenannte „carmen saeculare“ (Säkularlied), das von einem Chor - bestehend aus siebenundzwanzig jungen Mädchen und ebenso vielen Knaben - vorgetragen wurde. Die „ludi saeculares“ des Augustus hatten jedoch nicht nur die Vergangenheit Roms im Focus, sondern mit ihnen sollte auch das „saeculum aureum“ (das goldene Zeitalter) eingeläutet werden, das natürlich den „princeps“ Augustus zum Urheber hatte. Somit waren die augusteischen „ludi saeculares“ auch bestens geeignet, die Taten und Werke des Augustus besonders hervorzuheben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die „ludi saeculares“ auch in der Münzprägung des Augustus ihren Niederschlag fanden. Auf einige dieser Prägungen soll im Folgenden näher eingegangen werden.

Abb. 1 D, ca 17 v. Chr., Rom, RIC I2 Nr. 340
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18202474
Der in Rom vom Münzmeister Marcus Sanquinius geprägte Denar in Abb. 1 zeigt auf seiner Vorderseite eine nach links gerichtete, stehende Figur. Diese ist mit einem langen Gewand bekleidet. Auf dem Kopf trägt sie einen Helm, der beidseitig mit langen Federn geschmückt ist. Der angewinkelte linke Arm hält ein mit einem sechsstrahligen Stern verziertes Rundschild, während sich in der weit vorgestreckten rechten Hand ein großer „caduceus“, ein Heroldstab, befindet. Dieser ist für gewöhnlich ein Attribut des Götterboten Merkur. Daher wird diese Figur allgemein als Ausrufer bzw. Herold, lateinisch als „praeco“, bezeichnet. Dieser könnte evtl. die Prophezeihungen der Sibyllinischen Bücher verkündet haben. Die Aussage der Umschrift „AVGVST DIVI F LVDOS SAE“ (Augustus Divi Filius Ludos Saeculares - Augustus, der Sohn des vergöttlichten [Caesar], [hat] die Säkularspiele [ausgerichtet]) ist klar und deutlich. Auf der Rückseite findet sich zunächst der Hinweis auf den Münzmeister: „M SANQVINIVS III VIR“ (Marcus Sanquinius Triumvir [Auro, Argento, Aere, Flando, Feriundo] - Marcus Sanquinius Mitglied der Dreimänner [für das Schmelzen und Ausmünzen von Gold, Silber und Erz]). Die Münzlegende rahmt einen nach rechts gerichteten Porträtkopf, bei dem es sich aufgrund des vierstrahligen und geschweiften Kometen über der Stirn nur um Caius Iulius Caesar handeln kann. Der Komet stellt dementsprechend das „sidus Iulium“ dar, ein Komet, der im Jahr 44 v. Chr. sieben Tage am nordöstlichen Himmel Roms erschienen war. Neben dem „sidus Iulium“ trägt Caesar auch den Lorbeerkranz. Reversbild und Averslegende werden durch den vergöttlichen Caesar miteinander verbunden.
Abb. 2 AV, ca 17 v. Chr., Colonia Patricia ?, RIC I2 Nr. 138
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18206806
Der in Spanien, wohl in der Colonia Patricia, dem heutigen Cordoba, geprägte Aureus in Abb. 2 zeigt auf seinem Avers ein ganz traditionelles Bild: den nach rechts gerichteten Kopf des Augustus mit der kurzen Legende „CAESAR AVGVSTVS“. Auf der Rückseite des Aureus ist innerhalb eines Eichenkranzes im Zentrum des Bildes ein großer, fast quadratischer Altar oder Cippus dargestellt, auf dessen Front „LVDI SAECVL“ (Ludi Saeculares) eingeschrieben ist. Dementsprechend bezieht sich das Münzbild auch auf diese Feierlichkeiten. Auf der rechten Seite des Altars steht eine Figur, die der auf dem vorhergehenden Denar weitgehend gleicht. Der einzige Unterschied ist, das der Herold jetzt kein Rund-, sondern ein achtförmiges Schild trägt. Auf der anderen Altarseite steht ein Togatus, der seine Toga über den Kopf gezogen hat, man spricht hier von „capite velato“ (mit verhülltem Haupt). Dies war die übliche Tracht bei Opfern nach römischen Ritus. Zum Opfer passt auch die Geste der vorgestreckten Hand. Ob es sich hier um Augustus selbst handelt, wie manche meinen, muss dahingestellt bleiben. Über dem Altar stehen noch die Buchstaben „IMP“ für Imperator - ein Hinweis auf einen weiteren Titel des Kaisers. Das Münzbild insgesamt ist allerdings nicht ganz schlüssig, denn Herold und Opfernder passen nicht zusammen, d. h. es ist hierin kein reales Abbild einer Handlung anlässlich der „ludi saeculares“ zu sehen, sondern eher ein Überblick über bzw. eine Reminiszens an die Feiern.
Bei dem Denar in Abb. 3 handelt es sich wieder um eine Münzmeisterprägung, genauer um eine Prägung des Münzmeisters Lucius Mescinius Rufus. Auf dem Avers sehen wir den nach rechts gerichteten Kopf des Augustus mit Lorbeerkranz und der Umschrift „CAESAR AVGVSTVS TR POT“ (Caesar Augustus Tribunicia Potestas - …, Inhaber der tribunizischen Gewalt). Die Münzrückseite wird dominiert von zahlreichen Inschriften. Beginnen wir mit der außen umlaufenden Legende „[L MESCI]NIVS RVFVS III VIR“, die wie bei dem Denar in Abb. 1 den Münzmeister nennt. In Bildmitte ist ein Cippus dargestellt, der oben und unten reich mit Zierleisten versehen ist. Der Cippus ist in fünf Registern beschrieben: „IMP / CAES / AVG / LVD / SAEC“ (Imperator Caesar Augustus Ludi Saeculares). Rechts und links des Cippus finden sich noch die Worte „XV S F“ (XV Sacris Faciundis), wie wir sie schon vom Denar in Abb. 1 her kennen.
Abb. 3 D, 16 v. Chr., Rom, RIC I2 Nr. 354
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18207679
Auch hier wird wieder an die „ludi saeculares“ erinnert, evtl. nimmt der Cippus Bezug auf die Säulen mit den Inschriften der Akten der Priesterschaft der Quindecemviri. Insgesamt gesehen, zeigen unsere drei Münzbeispiele, dass die Münzbilder zu den „ludi saeculares“ nicht deskriptiv waren, sondern dass es sich eher um „Memorialmünzen“ handelt, d. h. Augustus wird hier als Urheber dieser Jahrhundertfeier verherrlicht.
Der nächste Kaiser, der eine Säkularfeier durchführen ließ, war Claudius. Claudius hielt sich bei der Festsetzung des Datums an die ursprüngliche Abfolge und feierte die Ludi im Jahr 47. Diese Feiern fanden allerdings keinen Niederschlag in der Münzprägung des Claudius. Im Gegensatz zu Claudius gibt es unter Domitian, der die „ludi saeculares“ im Jahr 88 abhielt, eine Fülle von Prägungen zu diesem Thema. Wir wollen uns hier nur auf die Münztypen beschränken, die in gewisser Weise augusteische Vorbilder aufgreifen.
Abb. 4 D, 88, Rom, RIC II-12 Nr. 596
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18232341
Domitian hielt sich offiziell an die von Augustus vorgegebene, 110-jährige Abfolge der „ludi saeculares“, feierte sie aber, wie der römische Historiker Sueton ausdrücklich betont, sechs Jahre zu früh. Der Denar in Abb. 4 zeigt auf seinem Avers Bild und Titulatur, wie wir es von domitianischen Prägungen kennen. Die Reverslegende „COS XIIII LVD SAEC FEC“ (Consul XIIII Ludos Saeculares Fecit - Konsul zum 14. Mal, er hat die Saekularfeier ausgerichtet) ist jetzt ausführlicher als auf den augusteischen Münzen, bei denen teilweise das „fecit“ gedanklich ergänzt werden musste. Die Angabe des 14. Konsulats datiert die Münze in das Jahr 88. Das Münzbild zeigt eine fast identische Darstellung wie auf dem augusteischen Denar in Abb. 1, wobei die Figur jetzt weit nach links ausschreitet. Anders ist auch der Gegenstand in der vorgestreckten rechten Hand. Es handelt sich hier nicht um einen „caduceus“, einen Heroldstab, sondern um einen einfachen Stab, d. h. hier ist nicht der „praeco“, der Herold oder Ausrufer, dargestellt, sondern ein „ludio“, ein Schauspieler, der den verschiedenen Festzügen voranschritt. Die domitianischen Stempelschneider haben durch das Ersetzen des „caduceus“ durch einen Stab das augusteische Vorbild leicht verändert und ihm dadurch eine ganz neue Bedeutung gegeben.
Abb. 5, D, 88, Rom, RIC II-12 Nr. 601
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18232342
Die Vorderseite des Denars in Abb. 5 bietet hinsichtlich Bild und Umschrift nicht Neues. Auf der Rückseite sehen wir rechts wieder den „ludio“ abgebildet. Sehr schön zu sehen ist sein reich verzierter Rundschild, der außen von einem „Perlkreis“ gerahmt wird, und der im Inneren eine Romabüste zeigt. Vor dem Schauspieler steht ein fast mannshoher Kandelaber und ganz links ein ebenfalls mannshoher Cippus, der auf seiner Schauseite eine fünfzeilige Inschrift trägt, die der Reverslegende des Denars in Abb. 4 entspricht. Ein direktes augusteisches Vorbild gibt es zwar nicht, doch kann man in diesem domitianischen Münzbild eine Verquickung der Rückseitenbilder der Denare in Abb. 1 und 3 sehen.
Abb. 6, D, 88, Rom, RIC II-12 Nr. 604
Bildquelle: https://numid.uni-mainz.de/object?id=ID625
Ähnliches gilt auch für unsere dritte domitianische Münze (Abb. 6), auf deren Rückseite innerhalb eines Lorbeerkranzes wieder ein Cippus abgebildet ist. Die Inschrift auf dem Cippus, ergänzt durch die Inschrift links und rechts davon, entspricht wiederum der Legende des Denars in Abb. 4. Die hier besprochenen Münzen Domitians, die eine enge Verbindung zu den augusteischen Münztypen besitzen, bilden sozusagen die Overtüre der umfangreichen domitianischen Prägungen zu den „ludi saeculares“ des Jahres 88. Diese müssen allerdings aufgrund ihrer Fülle einem späteren Artikel vorbehalten bleiben.
Horst Herzog















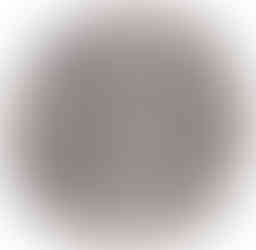








Kommentare