Aurei nummi - Goldmünzen Roms
- Horst Herzog

- 17. Okt. 2025
- 7 Min. Lesezeit
Bekanntlich begann die römische Republik relativ spät mit einer regulären Münzprägung. Erst im Lauf des dritten vorchristlichen Jahrhunderts wurde ein Münzsystem etabliert, wie es im griechischen Kulturraum schon mehrere Jahrhunderte üblich war. Dazu gehörte auch das Ausprägen von Münzen in unterschiedlichen Metallen, von denen das Edelmetall Gold natürlich am wertvollsten war. Der silberne Denar war zur Zeit der Republik die Hauptmünze. Goldmünzen wurden nur ausnahmsweise geschlagen.
Es ist in der Forschung allgemein anerkannt, dass das sogenannte „Schwurszenengold“ (Abb. 1 u. 2) die erste römische Goldprägung war. Es handelt sich hierbei um Statere (Abb. 1) bzw. Halbstatere (Abb. 2).

Abb. 1: Stater, ca 225 - 212 v. Chr., Rom, RRC 28/1
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18214723
Abb. 2: Halbstater, ca 225 - 212 v. Chr., Rom, RRC 28/2
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18201071
Auf dem Avers ist innerhalb eines feinen Perlkreises ein „doppelgesichtiger“ Kopf mit Lorbeerkranz abgebildet. Dieser wird teils als jugendlicher Januskopf, teils als janusförmiger Kopf der Dioskuren bezeichnet. Die Gesichtskonturen des Kopfes entsprechen dem klassischen, idealen Gesichtsprofil. Auf dem Revers ist eine dreifigurige Szene dargestellt. Auf einer Standlinie stehen links und rechts jeweils ein Soldat, während in der Mitte zwischen den beiden eine Person kniet. Der Kniende hält in seinen Armen ein Ferkel als Opfertier. Der linke, bärtige Soldat ist leicht nach vorne gebeugt, mit seiner linken Hand stützt er sich auf eine Lanze, in der Rechten hält er ein Schwert, mit dessen Spitze er das Ferkel
berührt. Der rechte Soldat zeigt ebenfalls mit der Spitze seines Schwertes auf das Ferkel. Im linken Arm hält dieser einen kurzen Speer mit der Spitze nach unten. Die Szene wird allgemein als Schwurszene interpretiert, daher resultiert auch die oben genannte Bezeichnung dieser ersten römischen Goldprägung als „Schwurszenengold“. Im Abschnitt unter der Standlinie ist „ROMA“ zu lesen. Deshalb wird auch als Münzstätte Rom angenommen. Umstritten ist die Datierung dieser Prägungen, sie schwankt zwischen 241 v. Chr., dem Ende des ersten punischen Krieges, und um 216 v. Chr., den Anfangsjahren des zweiten punischen Krieges. Das Gewicht des Staters beträgt 6,76 g, das des Halbstaters 3,43 g. Die Durchschnittsgewichte dieser Prägungen bewegen sich um 6,82 g bzw. 3,41 g.
Abb. 3: 60 As, ca 211 v. Chr., Rom, RRC 44/2
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18200936
Noch während des zweiten punischen Krieges, um 211 v. Chr., folgt die nächste römische Goldprägung, in unserem Beispiel (Abb. 3) im Wert von 60 As. Diese Münzen wurden auch im Wert von 20 (XX) und 40 (XXXX) As emittiert. Auf dem Avers sehen wir innerhalb eines Perlkreises den nach rechts gerichteten, bärtigen Kopf des Mars. Mars trägt einen korinthischen Helm, der wie bei griechischen Strategenporträts nach hinten geschoben ist, so dass das Gesicht frei bleibt. Der Gesichtskontur entspricht dem klassischer Bildnisse. Hinter dem Kopf sehen wir das Wertzeichen ↓X, wobei der Pfeil nach unten für das spätere römische Wertzeichen L (50) steht. Die Rückseite ist ohne Umrandung. Abgebildet ist ein nach rechts gerichteter Adler mit erhobenen Schwingen. In seinen Fängen hält er ein Blitzbündel. Im Abschnitt unter dem Adler erscheint wieder der Schriftzug „ROMA“. Der Adler mit dem Blitzbündel ist in der hellenistischen Welt ein gebräuchliches Münzbild und wurde erstmals von Ptolemaios I. Soter verwendet, wobei der Adler auf diesen Prägungen nach links gerichtet ist. Daher spielt das Münzbild der Mars/Adler-Serie eventuell auf eine Unterstützung Roms durch den ägyptischen König Ptolemaios IV. an. Das Bild des Kriegsgottes Mars auf dem Avers nimmt sicherlich Bezug auf die aktuellen kriegerischen Ereignisse. Das Gewicht unserer Beispielmünze beträgt 3,41 g.
Abb. 4: AV, 84 - 83 v. Chr., Athen (?), RRC 359/1
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18252808
Nach diesen frühen Prägungen dauert es über einhundert Jahre, bis die nächste römische Goldmünze geprägt wird. Erst unter Lucius Cornelius Sulla werden wieder Goldmünzen, jetzt spricht man schon von Aurei, emittiert. Der Aureus in Abb. 4 ist eine der frühen Goldprägungen Sullas. Es handelt sich um eine imperatorische Prägung, die in Griechenland, vielleicht in Athen, hergestellt wurde. Die Münzvorderseite zeigt innerhalb eines Perlkreises links den nach rechts gerichteten Kopf der Venus. Venus trägt im Haar ein Diadem; Perlohrringe und Perlenkette vervollständigen ihren Schmuck. Rechts neben dem Venuskopf steht auf einer Standlinie ein kleiner Eros, der mit seiner rechten Hand einen großen Palmzweig hält. Die Inschrift „L SVLL[A]“ unten im Abschnitt benennt den Herausgeber der Münze. Sulla nahm den Beinamen „Epaphroditus“ (Günstling der Aphrodite / Venus) an, unter anderem, da er glaubte, Venus habe ihn im Krieg gegen Mithridates unterstützt. Der Eros mit dem Palmzweig wird oftmals als Siegessymbol verwendet. Die programmatische Vorderseite wird durch das Rückseitenbild weiter ergänzt. Innerhalb eines Perlkreises sehen wir links und rechts jeweils ein Tropaeum, ein Siegesmal, stehen. Diese bestehen aus einem Pfahl mit einem Querholz auf Höhe der Arme. An dem Pfahl sind Panzer und Helm befestigt.. Zwischen den Tropaea sind eine Kanne und ein Lituus, ein Augurstab, abgebildet. Kanne und Lituus sind Priestergerätschaften und weisen auf das Augurenamt hin. Die beiden Tropaea könnten sich auf die Siege Sullas in Chaironeia und Orchomenos 86 v. Chr. gegen die Truppen des Mithridates von Pontos beziehen. Oben und unten befindet sich die Inschrift „IMPER ITERVM“ (Imperator Iterum - zum zweitenmal zum obersten Feldherrn ausgerufen). Das Rückseitenbild des Aureus ist wieder von einem Perlkranz gerahmt. Der sullanische Aureus wiegt 10,64 g, d. h. rund 1/30 des römischen Pfundes (libra) zu 327,5 g.
Abb. 5: AV, 47 v. Chr., Kleinasien (?), RRC 456/1
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18217123
Sowohl Pompeius Magnus als auch Marcus L. Crassus prägten Aurei, allerdings in geringer Auflage. So richtig setzt die Prägung der Aurei unter Caesar ein. Der Aureus wurde zu einer regulären Einheit des Münzsystems und mit 25 silbernen Denaren bewertet. Ein frühes Beispiel der Aurei Caesars ist der Aureus in Abb. 5. Auf dem Avers sind innerhalb eines Perlkreises ein Beil (securis) und ein zweihenkeliges Gefäß (culullus) abgebildet. Beide Gegenstände beziehen sich auf das Amt des Pontifex Maximus, welches Caesar seit 63 v. Chr. innehatte. Die vertikal angeordnete zweizeilige Inschrift der Münzvorderseite „CAESAR DICT“ (Caesar Dictator) findet ihre Fortsetzung auf dem Revers, jetzt horizontal: „ITER“ (zum zweiten Mal). Im Herbst 48 v. Chr. erhielt Caesar zum zweiten Mal die Diktatur. Auch auf der Rückseite sind priesterliche Gerätschaften dargestellt: innerhalb eines Lorbeerkranzes werden eine Kanne (sitella) und ein Augurstab (lituus) abgebildet. Beide Insignien stehen für das Augurat Caesars, das ihm im Lauf des Jahres 47 v. Chr. verliehen wurde. Der Lorbeerkranz bezieht sich sicherlich auf die Sieghaftigkeit Caesars im Allgemeinen. Das Gewicht unseres Aureus beträgt 7,95 g, das Durchschnittsgewicht der vierzehn bekannten Exemplare dieses Typs 8,05 g, womit wir uns schon dem ab 46 v. Chr. geltenden Standart für Goldmünzen von 1/40 des römischen Pfundes annähern. Während die Datierung des Aureus ins Jahr 47 v. Chr. als gesichert gilt, ist der Prägeort umstritten. Neben einem Prägeort in Kleinasien hat jüngst W. Hollstein aufgrund der Stempelstellungen, des Stils und historischer Gegebenheiten als Prägeort dieser kleinen Emission Korinth oder Sikyon vorgeschlagen.
Abb. 6: AV, ca 20 - 19 v. Chr., Cordoba (?), RIC I2 Nr. 53A
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18206797
Im Rahmen seiner Münzreform im Jahr 23 v. Chr. führte Augustus ein einheitliches, trimetallisches Münzsystem mit genauen Wertverhältnissen ein, das im Großen und Ganzen über mehrere Jahrhunderte Gültigkeit besaß: 1 Aureus = 25 Denare = 100 Sesterze = 200 Dupondien = 400 As. Der augusteische Aureus hatte jetzt ein Gewicht von 1/42 des römischen Pfundes. Das Gewicht des Aureus in Abb. 6 mit 7,81 g entspricht in etwa diesem Wert. Unser Aureus ist eine frühe Goldprägung des Augustus. Auf dem Avers ist innerhalb eines Perlkreises der nach rechts gerichtete Kopf des Augustus mit Lorbeerkranz abgebildet. Eine Legende ist nicht vorhanden. Das Porträt spricht wohl für sich. Auf der Rückseite sehen wir innerhalb einer Randlinie einen Altar mit einer ionischen Basis. Der obere Altarrand ist ebenfalls verziert, deutlich sichtbar sind die beiden Altarwangen. Die Altarfront dient als Hintergrund für die dreizeilige Inschrift: „FORT RED / CAES AVG / SPQR“ (Fortuna Redux Caesari Augusto Senatus Populusque Romanorum - Fortuna, die Caesar Augustus glücklich zurückgebracht hat, der Senat und das Volk der Römer). Der Altar der Fortuna Redux wurde nach der glücklichen und erfolgreichen Rückkehr des Augustus aus Kleinasien im Jahr 19 v. Chr. geweiht. Er stand in Rom in der Nähe der Porta Capena.
Im Lauf der folgenden Jahrhunderte wurde das Gewicht des Aureus langsam, aber doch stetig reduziert. So entsprach es unter Nero nur noch einem 1/45 Libra, unter Caracalla einem 1/50 Libra und in der Folgezeit schwankte das Aureusgewicht immer mehr. Eine gewisse Stabilität der Goldprägungen wird erst wieder unter Konstantin dem Großen erreicht.
Abb. 7 Solidus, ca 310 - 313, Trier, RIC VI Treveri Nr. 810
Bildquelle: https://ikmk.smb.museum/object?id=18229617
Im Jahr 309 wird unter der Herrschaft von Konstantin dem Großen der Aureus durch den Aureus Solidus, dem „dauerhaften, zuverlässigen Aureus“, ersetzt. Die ersten Solidi werden in der Münzstätte Trier geprägt. Das Gewicht des Solidus betrug 1/72 des römischen Pfundes, also rund 4,5 g. Unser Solidus in Abb. 7 liegt mit seinen 4,33 g etwas unter dieser Marke. Auf dem Avers ist der nach rechts gerichtete Kopf des Konstantin I. mit Lorbeerkranz abgebildet. Das Münzporträt wird durch die Legende „CONSTANTINVS P F AVG“ (Constantinus Pius Felix Augustus - Konstantin, der fromme und glückliche Kaiser) eindeutig benannt. Auf der Rückseite ist innerhalb eines Perlkreises eine vielfigurige Szene dargestellt. Auf einem hohen, rechteckigen Podest sitzt auf einer „sella curulis“ der Kaiser nach links gerichtet. Erkennbar ist dieser schon an seiner Größe, ist der Sitzende doch ebenso groß wie seine stehenden Begleiter, bei denen es sich aufgrund ihrer militärischen Tracht und ihrer Bewaffnung - u. a. mit jeweils zwei Speeren - um Offiziere handelt. Vor dem Podium knien drei Personen. Die dem Suggestus (Podium) am nächsten befindliche Figur hat beide Hände in einem „Unterwerfungsgestus“ erhoben, von der mittleren ist nur der Kopf zu sehen, und die hintere hat die Arme auf dem Rücken gefesselt. Daher dürfte es sich bei diesen drei Figuren um Gefangene handeln. Die Legende „FELICITAS REI PVBLICAE“ (Das Glück des Staates) beschwört die glückliche Zukunft des Imperiums, die durch die im Münzbild implizierte Sieghaftigkeit des Kaisers gewährleistet wird. Die Buchstabenkombination „PTR“ im Abschnitt ist ein Kürzel der Münzstätte Trier.
Dem Solidus ist eine lange Dauer als Leitwährung beschieden. Auch wenn er in seiner langen Geschichte Änderungen bzw. Gewichtsreduktionen unterzogen wurde, bleibt er letztendlich bis zur Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 im Umlauf.
Horst Herzog





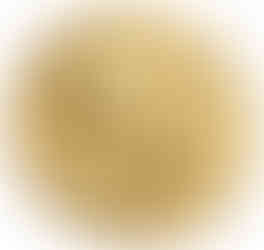






















Kommentare