Das Silber des Bankhauses Mendelssohn
- Dietmar Kreutzer

- 2. Mai 2025
- 5 Min. Lesezeit
Das Bankhaus Mendelssohn war einst eine der ersten deutschen Adressen. Zu dieser Größe war es jedoch ein langer Weg. Großfürst Alexander von Russland erinnerte 1932 daran, dass der Aufstieg viele kundige Akteure und Talente brauchte: "Die Rothschild und Mendelssohn sind das, was sie sind, nicht nur, weil so viel Gold in ihren Truhen liegt, sondern weil sie in einer mit Banktradition gesättigten Luft geboren sind. Die Gründer dieser Häuser mögen Selfmademen gewesen sein, aber erstens lebten sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als das Industriezeitalter noch jung war, und zweitens hat keiner von ihnen über Nacht ein Vermögen gesammelt. Sie brachten fast ein Jahrhundert, um 'die' Rothschild und 'die' Mendelssohn zu werden, obgleich sogar der Unbegabteste unter ihnen mehr vom Bankwesen verstand als die Wunderbankiers der Vereinigten Staaten." (1) Hier ein Überblick zur Geschichte des Hauses Mendelssohn.
Joseph Mendelsohn, ein Sohn des berühmten Berliner Philosophen Moses Mendelssohn, war der Begründer des Bankhauses. Im Jahr 1795 hatte sich der ausgebildete Kaufmann im elterlichen Haus mit Wechsel- und Bankgeschäften selbstständig gemacht. Die Firma florierte. Einige Zeit später trat auch sein jüngerer Bruder Abraham in das Unternehmen ein, das zu dieser Zeit auch über eine Niederlassung in Hamburg verfügte. Die französische Besatzung und die Befreiungskriege waren eine schwere Belastung für die Firma. Der jugendliche Benjamin (Georg) Mendelssohn schrieb am 12. Juli 1813 an seinen Vater Joseph, den Bankier: "Dein Brief, lieber Vater, vom 31. Juli macht mich allerdings betroffen, noch mehr, da mir alles davon dunkel ist. Es tut mir sehr leid, dass ich Dich meine Klagen habe anhören lassen, während Du selbst von einem ernsten Ungemach bedroht wirst und mit Sorgen zu kämpfen hast." (2) Die Schwierigkeiten ergaben sich aus der Kriegslage. Das Bankhaus der Gebrüder Mendelssohn hatte etwa eine illegale Lieferung von Gewehren aus Österreich nach Preußen veranlasst. Der Hauptteil der geschäftlichen Sorgen resultierte aber aus den häufigen Zwangsanleihen, die der preußische Staat in diesen Jahren erhob. Die Mendelssohns protestierten gegen deren Höhe. Im Jahr 1813 war z.B. in Berlin eine Zwangsanleihe von 9.000 Talern, dann 7.000 Talern festgesetzt worden. Als die Firma nicht zahlte, wurde eine militärische Zwangsbelegung der Wohnung der Mendelssohns angeordnet. Daraufhin brachte der Buchhalter der Firma am 11. April innerhalb von 24 Stunden immerhin 4.000 Taler auf. Die Mendelssohns erwogen in dieser Zeit, die in Berlin ansässige Firma aufzulösen.

Joseph Mendelssohn (1770-1848)
Bildquelle: Wikimedia, Itzuvit
Anfang 1815 zog die Firma J&A Mendelssohn vom Ephraim-Palais in der Berliner Poststraße in die Jägerstraße 51 am Gendarmenmarkt. Joseph Mendelssohn konnte das Gebäude im Jahr 1840 zum Preis von 70.000 Taler kaufen. Nach dem Tod des Firmengründers stieg das Bankhaus Mendelssohn & Co. unter der Leitung von Alexander Mendelssohn und Paul Mendelssohn-Bartholdy, dem Sohn von Abraham und zugleich jüngeren Bruder des Musikers Felix Mendelssohn Bartholdy, zum bedeutendsten Privatbankhaus in Deutschland auf. Es war die Zeit, in welcher der preußische Taler auf der Basis der Dresdener Münzvertrages von 1838 in weiten Teilen Deutschlands zur vorherrschenden Münze wurde. Durch das Kapital des Bankhauses Mendelssohn kamen insbesondere die russischen Eisenbahnen ins Rollen: "Im Jahre 1863 wurde das erste russische Eisenbahnpapier an der Berliner Börse eingeführt. Es handelte sich um eine fünfprozentige, vom russischen Staat zinsgarantierte Prioritätsanleihe der Moskau-Rjasan-Eisenbahn in Höhe von fünf Millionen Metallrubeln, was dem damaligen Gegenwert von etwa 5,4 Millionen preußischen Talern entsprach. (...) Drei Jahre später wurde eine erneute Eisenbahn-Anleihe aufgelegt, deren Ausgabe wahlweise in Pfund, Francs, Gulden oder Taler Preußisch-Courant erfolgte und die ebenfalls einen Zinssatz von fünf Prozent hatte." (3) Weitere Anleihen in vielfacher Millionenhöhe folgten. Damit avancierte Mendelssohn & Co. zu einem führenden Haus unter den Berliner Banken. In der Jägerstraße am Gendarmenmarkt waren bald sechs Grundstücke in der Hand der Mendelssohns. Die Bankiers Robert Mendelssohn und der inzwischen geadelte Franz von Mendelssohn ließen sich zudem Häuser im Grunewald bauen, einem vornehmen Villenviertel am Berliner Stadtrand.
Vereinstaler (Preußen, 1867, 900er Silber, 18,5 Gramm, 33 mm)
Bildquelle: Numista, Heritage Auctions

20 Mark (Preußen, 1875, 900er Gold, 8,0 Gramm, 22,5 mm)
Bildquelle: Münzkatalog-Online, Lanz
Inzwischen hatte die in ganz Deutschland gültige "Goldmark" den silbernen Taler abgelöst. Alle Aktiva und Passiva wurden in Mark ausgewiesen. Im Geschäftsgebaren sind jedoch nicht nur die großen Aktionen von Interesse, sondern manchmal auch kleinere Episoden, etwa der Brief von Robert Mendelssohn, der zeitweise mit Ernst Mendelssohn-Bartholdy die Geschäfte der Bank führte, an seinen Vater Franz vom 20. Juli 1882: "Du hast vielleicht in der Börsenzeitung den Schwindel von dem Kassenboten Rahn gelesen, zu dem eine Menge seiner kollegen ein derartiges Vertrauen hatten, dass sie ihm ihre sämtlichen Ersparnisse zum spekulieren anvertrauten; natürlich ist die Sache trotzdem sie sich wunderbarer Weise über zehn Jahre gehalten hat, den Weg allen Fleisches gewandelt, und der Kerl hat 50.000 Mark Defizit. Nun sind bei der Geschichte der Portier von Warschauers (...) mit 25.000 Mark, ein Kassenbote von Warschauers auch mit seiner ganzen Barschaft und unser alter solider Scheiding beteiligt. Dieser aber nur mit 900 Mark; er sagt, er habe vor sieben Jahren, als er zu uns kam, sein ganzes Geld zu uns gebracht und ihm (dem Rahn) nur diese kleine Summe gelassen, um ihn nicht zu beleidigen; wahr ist dies ohne Zweifel, da er bei uns 20.000 Mark gut hat. Ernst hat ihm auch vernünftigerweise keinen Rüffel gegeben, sondern ihn nur ganz allgemein auf die Dummheit derartiger Unternehmen aufmerksam gemacht. Nun aber kommt die Hauptsache: Ernst wollte im Anschluss an diese Geschichte ein schriftliches Zirkular aufsetzen, aufgrund dessen sich unsere sämtlichen Kommis durch Unterschrift verpflichten, nur durch uns sich ihre Papiere zu besorgen und durch niemand anders Geschäfte an der Börse zu machen, widrigenfalls sie ihre Entlassung zu gewärtigen hätten." (4)

Früheres Hauptgebäude des Bankhauses Mendelssohn & Co in der Berliner Jägerstr. 49/50
Bildquelle: Wikimedia, Zägel
Im Jahr 1909 gehörte der Firmeninhaber Ernst von Mendelssohn mit einem Vermögen von 43 Millionen Mark und einem Jahreseinkommen von drei Millionen Mark zu den reichsten Männern in Preußen. Den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik überstand das Bankhaus einermaßen glimpflich. Wenige Jahre nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war die Familie jedoch gezwungen, ihr Palais im Grunewald zu räumen. Das Bankhaus wurde im Jahr 1938 arisiert und von der Deutschen Bank geschluckt: "Wer sich heute auf die Suche nach Spuren der Mendelssohns im Grunewald begibt, findet kaum noch etwas, das an die Familie und ihre einstige glanzvolle Zeit erinnert. Wo sich früher die 50-Zimmer-Villa Franz von Mendelssohns befand, stehen heute eine Kirche, ein Jugendgästehaus sowie ein als Frommer Löffel bekanntes Restaurant." (5) Lediglich in der Berliner Jägerstraße gibt es noch Gebäude, die von der einstigen Bedeutung des Bankgeschäftes des Mendelssohns zeugen. Eine ehemalige Kassenhalle des historischen, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestockten Stammhauses in der Jägerstraße 51 wurde von der Mendelssohn-Gesellschaft zugunsten einer Dauerausstellung Die Mendelssohns in der Jägerstraße hergerichtet. In der Schau wird die Geschichte der Bank und ihrer Akteure thematisiert. Auch Veranstaltungen finden hier regelmäßig statt. Die beiden Wohn- und Geschäftshäuser der Mendelssohns in der Jägerstraße 52/53 wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. An ihrer Stelle befindet sich heute die Botschaft des Königreiches Belgien. Erhalten geblieben ist das zweigeschossige, palaisartige Gebäude in der Jägerstraße 49/50, in dem sich ab 1893 der Hauptsitz der Bankhauses Mendelssohn & Co befand. Nach der Wende war dieses "Mendelssohn-Palais" viele Jahre als Sitz der Bundesvereinigung der deutschen Apothekerverbände genutzt worden. Vor einigen Jahren ist es jedoch an einen bedeutenden Berliner Immobilienunternehmen verkauft worden.
Dietmar Kreutzer
Quellenangaben:
(1) Alexander von Russland: Kronzeuge des Jahrhunderts; Leipzig 1933, S. 282f.
(2) Bankiers, Künstler und Gelehrte: Unveröffentlichte Briefe der Familie Mendelssohn aus dem 19. Jahrhundert; Tübingen 1975, S. 22f.
(3) Julius H. Schoeps: Das Erbe der Mendelssohns - Biographie einer Familie; Frankfurt/Main 2013, S. 205f.
(4) Bankiers, Künstler und Gelehrte; S. 226
(5) Schoeps; S. 261






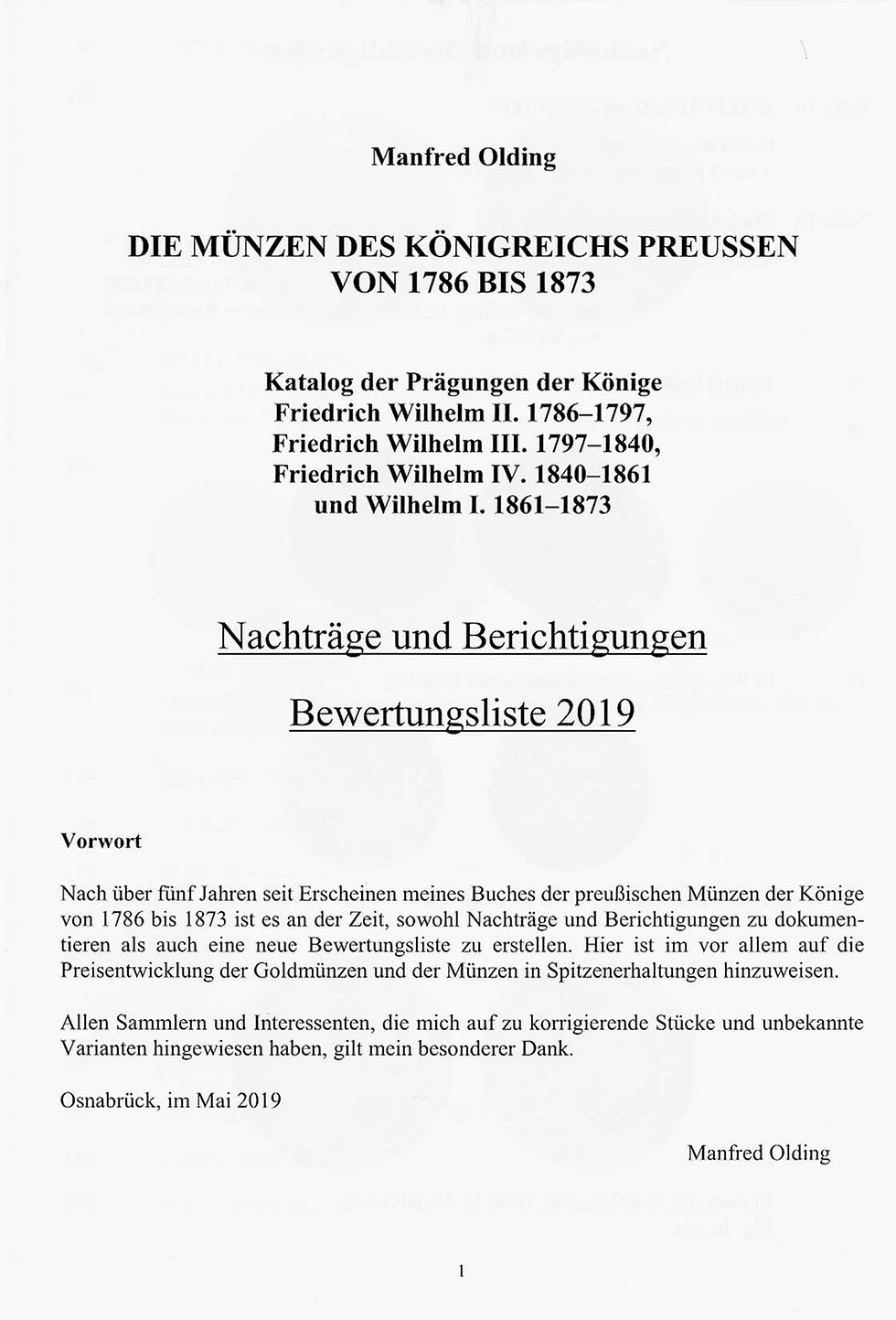

Kommentare